
2. Jg., Heft 2
November 1997
Maria Peters
Erschriebene Grenz-Gänge.
Raumwahrnehmung und ihre sprachliche Umsetzung
1„Ich schreibe anders als ich rede, ich rede anders, als ich denke, ich denke anders als ich denken soll, und so geht es weiter, bis ins tiefste Dunkel"
(Franz Kafka)
2Kafka charakterisiert hier einen Prozeß des Schreibens, Sprechens und Denkens, der durch ein ständiges Verrutschen des intendierten Sinns in Bewegung bleibt und durch die Begierde des Ausdrucks aufrechterhalten wird. Es geht um ein Schreiben und Sprechen, welches sich seiner selbst nicht sicher ist und das in seiner ganzen Denkbewegung ein Fragen darstellt, weil man nicht nur von dem schreibt und spricht, was man weiß, um es öffentlich auszustellen, sondern auch von dem, was man nicht weiß, um es in Erfahrung zu bringen.
3In der Schule, im Museum und in Seminaren der Universität inszeniere ich mit
Schülern und Studenten seit ein paar Jahren all-sinnliche, d.h. visuelle, taktile,
akustische und bewegungsorientierte Wahrnehmungsprozesse von Kunst und ihre schriftliche,
zeichnerische und gestisch-handelnde Vergegenwärtigung.
Anhand der Darstellung einer experimentellen Auseinandersetzung mit einer künstlerischen
Raum-Klang-Installation und ihrer schreibenden Symbolisierung werde ich im Folgenden
zeigen, wie ein sprachlicher Ausdruck, der sich seiner selbst nicht sicher ist und der
schreibend etwas in Erfahrung bringt, exemplarisch beschreibbar ist. Die Kunst und ihre
Rezeption eröffnet ein weites Erfahrungsfeld, um Beziehungen zwischen Subjekt und
‘Werk’ aufscheinen zu lassen, die auch über den Kontext der Kunst hinaus von
Bedeutung sind. Es kann eine Sprache entstehen, die nicht nur auf Verstehen angelegt ist,
sondern neue Sinnordnungen hervorbringt.
4Es geht mir um die Darstellung einer Erfahrungspraxis, in der die Bedeutung
von Räumen sich nicht darin erschöpft, den in ihr ein und ausgehenden Menschen ein
‘Dach’ über dem Kopf zu bieten.
Mein Beispiel einer experimentellen Auseinandersetzung mit Räumen soll zeigen, daß
Gebäude bzw. das „Ein-Wohnen" in ihnen als eine Inszenierung zeitlicher und
räumlicher Erfahrungszusammenhänge angesehen werden kann. Ich gehe davon aus, daß
Architektur sinnlich-reale Körpererfahrungen vermittelt, die das Individuum mit seinen
Erinnerungen, Wünschen oder Erwartungen, kurz: mit seinen gedanklichen Projektionen
füllt. So ist Architektur Teil einer menschlichen Praxis, in der komplexe Wahrnehmungen
und ihre sprachliche Vergegenwärtigung Erlebnis- und Erfahrungsmuster erzeugen, die sich
unter Umständen als vielfältige Lebensentwürfe im Einzelnen verankern.
5Aus der phänomenologisch orientierten Sicht des Philosophen Maurice
Merleau-Ponty konstituieren sich Räume erst in unserer Sinneserfahrung; Raum entsteht
allererst in den eigenen Wahrnehmungsbewegungen. Zum anderen können wir auch nur durch
die Sinnestätigkeit und die Bewegungen im Raum ein Bewußtsein für unser Wahrnehmungs-
und Empfindungsvermögen entwickeln.
Merleau-Ponty differenziert in diesem Zusammenhang die Bewegungen in ‘konkrete’
und ‘Ausdrucks-’ Gesten. Beide Weisen der Bewegung sind eng miteinander
verknüpft als zwei Dimensionen des Wahrnehmungsverhaltens, die unmerklich ineinander
übergehen. In der ‘konkreten’ Bewegung wird der Körper instrumentalisiert. Er
nimmt dem Raum gegenüber eine zweckorientierte Haltung ein. Man geht durch den Raum mit
einer bestimmten praktisch-zielgerichteten Intention. In der Ausdrucksgebärde ist der
Körper nicht mehr ‘Vehikel der Bewegung’, sondern das Subjekt nimmt sich in
seiner Beziehung zum Raum selbst wahr. Es entsteht dabei eine
‘Situationsräumlichkeit’ und keine ‘Positionsräumlichkeit’, d.h. der
Körper wohnt im Raum und in der Zeit ein, weil die Ausdrucksbewegung Raum
und Zeit nicht einfach über sich ergehen läßt, sondern aktiv erst selbst hervorbringt (Siehe
Maurice Merleau-Ponty: Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin 1966, S. 123ff)
6In der Ausdruckgebärde verknüpfen sich das wahrnehmende Subjekt und der wahrgenommene Raum, und es entsteht eine Zwischensphäre, eine mediale Sphäre, in der es gleichermaßen um das Vernehmen des Raumes wie um die Spürbarkeit dieses eigenen Vernehmens im körperlichen Sensorium geht. Die Ausdrucksgebärde macht eine ästhetische Haltung zur Welt sichtbar. In dieser ästhetischen Haltung kann ein zeitliches und örtliches Verweilen im Raum spürbar machen, wie sich in der Vielperspektivität der Wahrnehmungen bekannte Erfahrungen zugunsten von innovativem Sinn verwandeln. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschieben sich ineinander und konstituieren zwischen Subjekt und Raum einen dynamischen Ort der Präsenz, der heterogen und nicht zu fassen ist.
7Die ständigen Veränderungs- und Verformungsbewegungen der Ausdrucksgebärde
lassen die Frage nach einer beginnenden Sinnstiftung, nach dem Beginn von Sprache
unbeantwortet. Wir befinden uns in einem Dilemma des Übergangs, in dem sich nicht
ausmachen läßt, wann etwas eine bestimmte Bedeutung annahm. Eine alles durchdringende
Reflexivität, die in kritischer Distanz über das Ganze der Erfahrungen zu urteilen
vermag, ist aus phänomenologischer Sicht unmöglich. Die eigentlichen
Wahrnehmungsvorgänge liegen uns im Rücken und können nur in der Ausdrucksgebärde, z.B.
durch Sprache, symbolisch transformiert und dadurch für uns ansatzweise erfahrbar werden.
Merleau-Ponty hebt in der Selbst- und Raumwahrnehmung die Entstehung einer Sprache hervor,
die nicht von festgelegten Wissensbeständen und übernommenen Erkenntnissen ausgeht,
sondern die versucht, die ständigen Veränderungen und Verschiebungen der eigenen
Wahrnehmungen und Gedanken mitauszudrücken. Korrespondierend zu der zeitlichen und
örtlichen Selbst- und Verlaufspräsens im Wahrnehmungsprozeß trägt diese Form des
prozeßorientierten Sprechens und Schreibens ebenfalls ästhetische Züge. Claude
Lévi-Strauß kennzeichnet diese Sprache als ‘wild’, da sie unbeständig,
krisenhaft, verletzend und verletzbar, heterogen und diskontinuierlich ist. (Siehe
Claude Lévi-Stauß: Das wilde Denken. Frankfurt a. Main 1968.)
8Diese Form des ästhetischen Sprechens und Schreibens ist eine Grenzerfahrung. Wer die Sprache ästhetisch, also in ihrer Veränderlichkeit und Übergänglichkeit erfährt, befindet sich nicht mehr in der Sicherheit instrumentell vermittelter Ordnungen; aber er ist auch noch nicht bei jenem Sinn, den er im Sprechen und Schreiben zu gewinnen erhofft. Gleicherweise durch das Nicht-mehr wie durch das Noch-nicht gekennzeichnet, macht die ästhetische Weise des Sprechens und Schreibens eine Erfahrung im Dazwischen sichtbar.
9An einem Beispiel aus meiner Seminarpraxis werde ich nun zeigen, wie komplexe
und experimentelle Wahrnehmungen von Räumen eine ästhetische Weise des Schreibens und
wilden Denkens evozieren können. Es handelt sich um eine Audio-Führung, die das
Künstlerpaar Pina und Via Lewandowsky für die Räume der Rostocker Kunsthalle im Sommer
1996 hergestellt haben.
Auf dem Tonband ist zu hören, wie ein Operator - es ist eine Frauenstimme - eine
‘Testperson’, dargestellt als männliche Stimme, durch Räume und Gänge der
Rostocker Kunsthalle führt. Anders als bei einer traditionellen Museumsführung, werden
auf dem Tonband aber keine ausgestellten Bilder besprochen, sondern Orte jenseits der
offiziellen Ausstellungsflächen aufgesucht. Statt äußerer Kunstwerke steht die
Wahrnehmung und Beschreibung von ‘inneren’ Bildern und Ereignissen im
Mittelpunkt der Führung. Das Verwirrende an der Sache ist nun, daß die Frauenstimme
nicht direkt mit der zu führenden Testperson spricht, sondern mit dessen Bewußtsein. Das
geht - und hier setzt die Fiktion ein -, weil das Bewußtsein der geführten Person sich
in einer Mikrozelle befindet, die durch den Körper dieser Person wandert. Also, während
die Frauenstimme eine Testperson durch die Räume der Rostocker Kunsthalle führt, wandert
gleichzeitig das Bewußtsein dieser Testperson als Mikrozelle durch den Körper des
Geführten.
10Wenn sich bei Ihnen gerade zunehmende Verwirrung ausbreitet, so verzweifeln Sie nicht. Es ist die beste Voraussetzung, sich in den Gemütszustand der Studenten während der Aktion einzufühlen und damit die Wirkungskräfte der Audio-Führung am eigenen Leibe zu verstehen. Verwirrungen gehören unmittelbar mit zum Geschehen.
11Zurück zum Experiment:
Diese für die Räume der Rostocker Kunsthalle gedachte Tonbandführung haben nun die
Studenten per Walkman im erziehungswissenschaftlichen Gebäude in Hamburg gehört,
während sie durch die Räume und Gänge des Hauses liefen. Sie hatten dazu den Hinweis
bekommen, ihre Wahrnehmungen, Empfindungen, Assoziationen und Gedanken ununterbrochen im
Gehen aufzuschreiben.
12Vier räumliche Ebenen wurden bei diesem Audio-Experiment wirksam:
Die Ausstellungsräume der Rostocker Kunsthalle, durch die die Testperson von der
Frauenstimme akustisch geführt wird; die Körperinnenräume der Testperson, die von
seinem Bewußtsein in der wandernden Mikro-Zelle beschrieben werden, die Räumlichkeiten
des Erziehungswissenschaftlichen Gebäudes, durch das die Studenten beim Hören wanderten
und ihre eigenen Körper-, Empfindungs- und Gedankenräume, die im Schreiben
vergegenwärtigt wurden.
13Damit Sie sich ein Bild machen können, wie diese räumlichen Ebenen in dem Audio-Experiment zusammenwirken, zeige ich Ihnen einen Ausschnitt aus einem Video.
(das Video hat eine Größe von 55 MB und
kann mit Quick Time for Windows angesehen werden.
Sie können das Programm hier downloaden
und auf Ihrem Rechner installieren)
Hier einige Standbilder aus diesem Video:


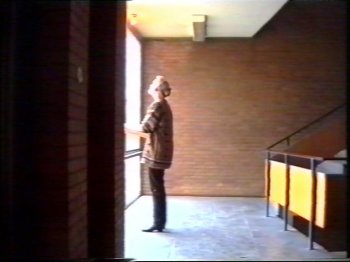
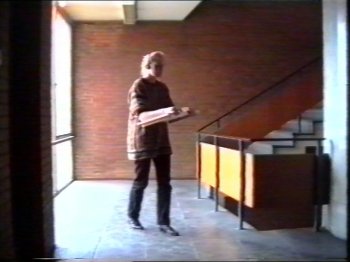

Ich habe die Studenten bei ihren Wanderungen mit der Videokamera beobachtet und davon
Bewegungsausschnitte mit Sequenzen aus der Tonbandführung unterlegt.
Das Video versucht also, das Zusammentreffen von akustischen und visuellen Wahrnehmungen
und ihre oftmals zufällige Sinnbildung - wie sie die Studenten erlebt haben - zu
simulieren und für Sie nachvollziehbar zu machen.
14Die Verschränkungen von Hören, Sehen, Gehen und Schreiben haben die
Studenten als anstrengende, ja teilweise als unzumutbare Überforderung erlebt.
Die örtliche Verschiebung der Audio-Führung von der Rostocker Kunsthalle in das
Erziehungswissenschaftliche Gebäude in Hamburg hat zu räumlichen und zeitlichen
Differenzerfahrungen geführt. Es war anstrengend, weil die Studenten im Hören, in der
eigenen Bewegung und im Schreiben ständig bemüht waren, die Irritationen und Spannungen,
die zwischen den gehörten Bildern und der augenblicklich sichtbaren Realität entstanden,
auszuhalten und im Schreiben produktiv zu wenden. Überraschende, weil zufällige
Korrespondenzen zwischen dem Gehörten und dem Gesehenen hielten dabei eine Begierde nach
weiterer Sinnstiftung aufrecht.
15In der Untersuchung der Texte wird deutlich, daß sich die Bedingungen des
Schreibanlasses, also die vieldimensionalen Raumwahrnehmungen und die inhaltliche und
formale Gestaltung des Tonbandes auf unterschiedliche Weise sprachlich transformiert
haben. Dies soll an einigen Beispielen erläutert werden.
In den Texten wird die von Merleau-Ponty charakterisierte Zwischensphäre der Wahrnehmung
deutlich, in der sich das Subjekt als zum einen aktiv Wahrnehmender und zum anderen passiv
Wahrgenommener gleichermaßen erfahren kann.
In den Texten 1-3 wird eine solche mal aktive, mal passive Reflexion ausgedrückt.
16„Ich sehe mich in einem großen Spiegel. Werde immer größer .... größer..."
17„Der Sprecher bewegt sich durch einen Körper. Ich werde bewegt durch einen Baukörper. Ich bewege mich in mir".
18„Ich bin eine (ge)wanderte(nde) Zelle". ----- [beide Versionen lesen].
19Im Laufen und Hören unterliegt der Student einem permanenten Wechsel seines
Standpunktes. Er transformiert Inneres in ein Außen und Äußeres in ein Innen. Diese
Verschränkungen nennt der japanische Geisteswissenschaftler Hosokawa den Walkman-Effekt.
Durch die drängenden und ständig sich forttreibenden Formulierungen in der
Audio-Führung setzten Verweigerungs- und Widerstandsbewegungen gegen die dominante Stimme
der Frau ein, die auch in partielle Identifikationen mit der geführten Testperson
mündeten. Der Widerstand und die sich ansammelnden Agressionen verschafften sich in
bildreichen Wortzusammenballungen Ausdruck.
20„Blut läuft aus meinem Trommelfell. Halt die Klappe. Ich bring Dich um. Magenzellen verklumpen vor wutgesammelter Körperverlorenheit. Kohorten gasgefüllter Gasblasen durchrinnen die Nervenstränge. Violette Sinne. Die Augen kriechen ins Innere, um die restlichen Abwehrmechanismen zu unterstützen. Ich verfaule an der Peripherie. Er hat es geschafft, hat mich durchdrungen, vereinnahmt, ich bin verloren, bin er, er, er. Aufgebendes Ich".
21In der Audio-Führung wurde etwas von woanders her übertragen und präsent gemacht. Diese örtlichen Verschiebungen führten zu einem veränderten Raum- und Zeitempfinden.
22„Ein eigener Raum ist entstanden. Die gegebenen Räumlichkeiten verblassen immer mehr. Da den Anweisungen der Sprecherin nicht Folge zu leisten war, wurde sie von mir vollständig ignoriert. Durch das „Gebrabbel" der Wanderzelle, das inhaltlich nicht vollständig - eher nur ein geringer Teil - verstanden wurde, wurde eine Stimmung erzeugt, die eine andere Raumwahrnehmung ermöglichte. So etwas wie ein „Zwischenraum" entstand. Die Zeit wurde ebenfalls als eine Art „Zwischenzeit" wahrgenommen. Ich wurde immer langsamer in meinen Bewegungen, die meßbare Zeit aber rannte".
23In Text 5 wird diese Differenzerfahrung als eine Erfahrung im ‘Zwischenraum’ und in einer ‘Zwischenzeit’ beschrieben, die zu Verlangsamungen führte. Die Texte zeigen, daß in der medialen örtlichen und zeitlichen Verrückung vertraute, bisher nur zweckorientiert wahrgenommene Räume und Dinge mit Bedeutung aufgeladen wurden, die neue ‘Blicke’ auf Altbekanntes eröffneten. Im Sinne Merleau-Ponty’s verwandeln sich ‘konkrete’ Bewegungen unmerklich in sprachliche Ausdrucksgebärden. Dabei wird das Gehen zum Abenteuer und das Selbstverständliche durchbrochen:
24„Ich stehe am Rande eines vollen Aschenbechers, den mir meine Mit-Studenten im Laufe des Tages zugefügt haben"
25Der Ausstellungsraum ist eine Bibliothek od. die Ausstellung einer Bücherei: tote, eingeschlafene Wanderzellen, Wunderblöcke in Regalen, warten lange, unbeweglich - am Rande einer Gewebespalte. ..Die Museumspädagogik ist vollbesetzt, die Innereien drohen zu verstopfen: gedrucktes verläßt ständig die selbe Kloake, in die auch neues Papier eingeführt wird... Eine Bibliothek zeigt sich als Verdauungstrakt eines Universitätsinstitutes".
26Die Texte lassen ahnen, daß die ästhetischen Potentiale in einem komplexen
Wahrnehmungsprozeß explosiv sein können. Im schnellen Wechsel zwischen Aktiv und Passiv
generiert sich das Subjekt in einem oszillierenden Raum-Zeit-Gefüge.
Auch syntaktisch wird an den Texten eine Verschiebung, Verwandlung und
‘Neu-Konstruktion’ von Wirklichkeit nachvollziehbar. In ihrem additiven Verlauf
- d.h. ein Satzfragment reiht sich an das andere - sind die Texte offen, haben keinen
Anfang und kein Ende. Sie sind nicht hierachisch strukturiert, sondern bieten eine
unüberschaubare Zahl von Anschlüssen und Möglichkeiten zur Sinnfortschreibung. Anstelle
von Stabilität dominiert in den Texten Veränderlichkeit, und anstatt die Realität
abzubilden, eröffnen sie Möglichkeitsräume.
27Mit dem Bild der ‘erschriebenen Grenz-Gänge’ - wie es im Titel
angelegt ist - geht es mir nicht um den Ausdruck einer ‘Entgrenzung’ der Sprache
im Sinne eines beliebigen 'anything goes'. Ich möchte dagegen die „Bildsamkeit"
eines kritischen, weil differenzorientierten Vermögens im Umgang mit der Grenze des
Sagbaren und (noch) Unsagbaren hervorheben. Es handelt sich hier um eine risikoreiche
Bewegung zwischen Eindeutigkeit und Mehrdimensionalität, die sich in einer ästhetischen
Auseinandersetzung mit Räumen sprachlich vergegenwärtigt.
Damit wird eine unmittelbare Verknüpfung von Raum und Sprache evident: Raumwahrnehmungen
und Sprache bedingen und verschränken sich gegenseitig - die Sinneswahrnehmungen
konstituieren und fundieren die Sprache, so wie die Sprache in ihrer körperlichen
Gebundenheit die unendliche und offene Reihe von Raumerfahrungen erst generierend
hervorbringt und vergegenwärtigend sichtbar macht.
28Pointierter ausgedrückt, kann man sagen:
Raum entsteht nur, wenn er kommuniziert wird. Wird er nicht kommuniziert, so ist er auch
nicht. Je mehr der Raum kommuniziert wird, desto mehr ist er auch.


