
Die
Zukunft
der Architekturvermittlung
Doppelheft 1-2
Februar 2007
 |
Die
Zukunft |
|
|
11. Jahrgang Doppelheft 1-2 Februar 2007 |
| ___Carsten
Ruhl Bochum |
Die Vermittlung ist
das Werk Zur Verselbstständigung des Ausstellens bei Herzog & de Meuron |
|
Man ist es von Künstlern gewohnt, dass sie ein ambivalentes Verhältnis zur verbalen Vermittlung ihrer Werke pflegen. Einerseits lamentieren sie gern über das Gerede, das um ihre Kunst gemacht wird, andererseits sind sie auf die erklärende Interpretation des Unaussprechlichen angewiesen, soll ihr Werk einen festen Platz im sakralen Raum der Galerien und Museen erhalten. In der Architektur, so muss mit Blick auf die letzten Jahre festgestellt werden, verhält es sich da nicht anders. Nach den zahlreichen postmodernen Legitimationsstrategien, die noch einmal eine Vielzahl von architekturtheoretischen Statements mit dem Blick für das Ganze hervorbrachten, beharren Architekten wie Jacques Herzog & Pierre de Meuron nunmehr darauf, dass sich Architektur im Wesentlichen durch sich selbst erkläre. „Architektur sei Architektur“, hatte Aldo Rossi den beiden während ihrer Zeit als Studenten der ETH Zürich eingeschärft (Brausch & Emery, 1995, 27-45). An dieses Schweigegelübde hatte sich indes schon Rossi nicht gehalten. Er avancierte zu einem der wichtigsten Theoretiker seines Faches, indem er in zahlreichen Schriften, Essays und Manifesten erklärte, was sich eigentlich durch das Gebaute mitzuteilen hatte. Sprachlosigkeit in der Architektur, so hat es den Anschein, scheitert an der permanenten theoretischen Begründung derselben. Ein Paradox, dem sich auch Herzog & de Meuron nur schwerlich entziehen können. In zahlreichen Interviews versichern sie immer wieder aufs Neue, sie verglichen sich nicht mit anderen Architekten oder Gruppierungen, akzeptierten keine verbindlichen Regeln oder ästhetischen Formalismen. Dass derartige Originalitätsbekundungen wiederum in das Reich avantgardistischer Mythenbildung gehören, muss nicht eigens betont werden. Bemerkenswert aber ist, dass jene programmatische Ablehnung eines verbindlichen Gedankengebäudes keine Legitimation mehr in einem größeren theoretischen Rahmen erfährt. Die Architektur sei vielmehr eine philosophische Rede und keine Philosophie, behaupten die Architekten feinsinnig. Was aber will uns dann das steinerne Artefakt übermitteln? Das freie Spiel der Erkenntniskräfte? Die Zurschaustellung architektonischer Mittel um der Mittel wegen? L’architecture pour l’architecture? |
||
 Abbildung 1: Außenansicht Schaulager Basel, 2003  Abbildung 2: Ricola-Europe Mulhouse, 1992-1993  Abbildung 3: Fassadendetail der Bibliothek in Eberswalde, 1994-1999  Abbildung 4: Bibliothek der BTU Cottbus, 2005  Abbildung 5: Innenansicht Schaulager Basel  Abbildung 6: Ausstellungskatalog Naturgeschichte, Blatt mit Fossilen  Abbildung 7: Ausstellungskatalog Naturgeschichte, Blatt mit morphologischen Studien |
Schenkt man den Architekten
Glauben, so lassen sich jene Fragen, denen sie selbst in ihren zahlreichen
Texten durch eine verbindliche Unverbindlichkeit auszuweichen scheinen, in
Anschauung der Bauten selbst beantworten. Mit Blick auf das Schaulager in
Basel (2000-2003) hatte indes schon Stanislaus von Moos in einem klugen
Aufsatz konstatiert, dass sich die Architektur durch ihre „perverse
Dialektik der Enthüllung und der Vorenthaltung“ (von Moos, 2004) einer
eindeutigen Festlegung zu entziehen sucht (Abbildung 1). Dies aber nicht,
indem sie sich nun tatsächlich von allen architektonischen Konventionen
verabschiedete. Das Gegenteil ist der Fall. Der Verwertungszyklus topischer
Motive wird erst durch die polysemantische Ausrichtung des Gebäudes so
richtig angekurbelt. Dies geschieht indes äußerst elaboriert, wie der Blick
auf die proszeniumsartige Straßenfront des Basler Kunstsilos zu zeigen
vermag. Vor einer weißen, sich trichterförmig öffnenden Wand, die an einen
aufgefalteten „white cube“ erinnert, steht gleichsam als Vorposten der Kunst
ein kleines, archaisch wirkendes Häuschen. Die Aufgaben, die dieses
pittoreske Motiv zu erfüllen hat, scheinen vielfältig. Davon abgesehen, dass
es gemeinsam mit dem äußerst abweisend wirkenden Zaun eine Schutzzone
bildet, die den Kunstschrein vor unerwünschten Gästen bewahren soll,
erinnert es an den Archetypus der Urhütte, wie ihn bereits Oswald Mathias
Ungers 1984 im Deutschen Architekturmuseum als permanentes Exponat, als Haus
im Haus, installiert hatte. Wo Ungers aber noch das Ziel verfolgt, die
Differenz zwischen Bild und Bau im ästhetischen Freiraum des Museums zu
überbrücken, damit die angenommenen rationalen Grundlagen der Architektur
umso klarer vor Augen treten können, erodieren bei Herzog & de Meuron mit
den maßstäblichen Konventionen auch derartige Zielsetzungen.
Architektonische Autonomie legitimiert sich jetzt nicht mehr durch
typologische, morphologische oder geometrische Erklärungsmodelle. An die
Stelle rationalistischer Selbstbeschränkungen, der Vorstellung einer
letztlich übersinnlichen architektonischen Wahrheit, tritt jetzt die Idee
einer Architektur, die die sinnliche Herausforderung annimmt, „die immer
schneller und heftiger auf uns einstürzenden Bilder zu neuen, bildhaften,
architektonischen Räumen“ zu gestalten (Herzog & de Meuron, 2000, 225). Damit wird der Fokus auf eines der zentralen Themen im Werk Herzog & de Meurons gelenkt, das immer wieder in unterschiedlichsten Konfigurationen durchgespielt wird: Die Architektur als Ausstellendes und Ausgestelltes. Nicht selten sind die Baukörper ihrer spektakulären Projekte wie in frühneuzeitlichen Repräsentationsbauten mit Bildern einer Ausstellung übersäht. Die europäische Niederlassung von Ricola in Mulhouse (1992-1993) ziert Karl Blossfelds fotografische Aufnahme der Doldigen Schafgarbe, die vielfach reproduziert von innen auf die transparenten Polycarbonatplatten der Fassade gedruckt ist (Abbildung 2). In der Bibliothek von Eberswalde (1994-1999) hingegen bilden in Glas geätzte Inkunabeln der Architektur- und Kunstgeschichte ein „all-over“, das das Gebäude wie tätowiert erscheinen lässt (Abbildung 3). Allein die schmalen querrechteckigen Fenster sowie die helleren jeweils von einem umlaufenden Fensterband hinterfangenen Gemälde-Reproduktionen strukturieren das sockellos aufragende Gebäude. Dabei werden die wenigen Fensterschlitze bisweilen selbst zu eingerahmten Bildern, die wiederum auf die Funktion des Gebäudes als Bibliothek, das heißt als Büchergalerie, verweisen. In der 2005 fertig gestellten Bibliothek der BTU Cottbus schließlich (Abbildung 4) haben nun die Buchstaben selbst die Enge zwischen zwei Buchdeckeln verlassen, um sich zu einem babylonischen Sprachornament zusammenzufügen, das mal transparent, mal opak, mal seltsam entrückt wirkt und dabei ständig zwischen Schrift und Ornament oszilliert. Was liegt angesichts solcher „bilddurchtränkter Räume“ näher, als dass die Architekten nun selbst zu Ausstellungsmachern werden und derartige Projekte als gleichberechtigte Schöpfungen an die Seite ihrer realisierten Bauten stellen. Nicht, um wie in den vergangenen Ausstellungen des 20. Jahrhunderts Programme zu vertreten, Stile zu verkünden oder gar Geschlossenheit der avantgardistischen Kräfte zu demonstrieren. Die letzten halbherzigen Versuche dieser Art wie etwa die von Philip Johnson und Mark Wigley Ende der achtziger Jahre kuratierte Ausstellung „Dekonstruktivistische Architektur“ (Johnson & Wigley, 1988/1 und 1988/2) waren ohnehin schon von einem gewissen Unbehagen in dieser Hinsicht geprägt. Gleich zu Beginn des Kataloges versichern die Kuratoren, dass Dekonstruktivistische Architektur kein neuer Stil sei und sich fundamental von der „messianischen Inbrunst der modernen Bewegung“ unterscheide (Johnson & Wigley, 1988/2, 7). Auch die Präsentationen Herzog & de Meurons scheinen über jeden Dogmatismus-Verdacht erhaben. Weder eine bestimmte Idee noch eine Theorie steht im Vordergrund, und sei es auch nur in der Negation des Bestehenden. Allein das Werk der Basler Architekten mit seinen biografischen, architektur- und kunsthistorischen Verflechtungen steht im Mittelpunkt der Reflexion, die als ein konzeptionell unabgeschlossenes philosophisches Gedankengebäude aus Bildern, Modellen und Texten verstanden werden will. Die in dieser Hinsicht vielleicht überzeugendste Ausstellung war vor drei Jahren im Canadian Centre for Architecture (vgl. hierzu Ursprung, 2002) zu bestaunen, bevor sie in Europa das Schaulager in Basel eröffnete (Abbildung 5). „Archaeology of the Mind“, so der Titel, unter dem sich, für eine Architekturausstellung ungewöhnlich, keine repräsentativen Modelle und Bilder zu einem Werkkatalog verdichteten. Stattdessen präsentierte man objets trouvés, das heißt den sedimentierten Abfall des architektonischen Schöpfungsprozesses. Die Architekten öffneten hierzu ihr Archiv und die Kuratoren machten sich in Dankbarkeit über das dargebotene Material her, das sie in der Attitüde eines Archäologen bargen, sichteten, kategorisierten und mit Fossilien konfrontierten. Am Ende präsentierte sich eine Art Wunderkammer analogischer Beziehungen zwischen Natur, Architektur und Kunst (Abbildungen 6 und 7). Dieser Konzeption entsprechend, versteht sich der begleitende Ausstellungskatalog als „Naturgeschichte“. Das heißt, die sinnlichen Phänomene werden auf der Grundlage physiologischer Ähnlichkeiten einer taxonomischen Ordnung unterzogen, aus der sich dann vier Kapitel ergeben. Deren Überschriften erinnern ebenso wie schon der Titel der Ausstellung an Michel Foucaults Archäologie des Wissens: Transformation und Verfremdung, Aneignung und Umbau, Lagern und Komprimieren, Eindruck und Ausdruck, Verschachtelte Räume, Schönheit und Atmosphäre. Was bei Foucault indes der epistemologischen Analyse dient, die sich weigert, die Geschichte des Denkens in Autoren, Biographismen, Denkschulen, teleologischen Entwicklungen und glorreichen Zivilisationsprozessen einzuteilen, gerät hier nur bedingt zur klärenden Entschleierung vormals unbewusster Wissensstrukturen. Im Gegenteil, vor den Augen des Lesers breitet sich eine schier unübersichtliche Bilderwelt aus, die allein noch dazu dient, den imaginativen Reichtum der Architekten zu dokumentieren. Als wäre dies nicht schon genug, übertreffen sich die verpflichteten Kuratoren, Kritiker, Wissenschaftler und Künstler in der Generierung tief schürfender Bedeutungshorizonte, die alles mit allem verbunden erscheinen lassen und die, im Sinne eines neuen Biographismus, die Sozialisation der Architekten zum Ausgangspunkt gewagter Spekulationen nehmen. Die Künstler selbst indessen betonen ihre Verwunderung über die hergestellten Kontexte, so als ob sie an dem eigentlichen Ausstellungsprojekt nicht beteiligt seien, ja gar vom jenseitigen Parnass der Baukunst auf die Systematisierungsversuche ihrer Nachwelt allenfalls wohlwollend hinabschauten. Doch auch dies gehört, ebenso wie die Attitüde der Kuratoren, zu jenem inszenierten „tableau vivant“, das für die Architekten den Charakter eines Experimentierfeldes hat und sich allein deswegen schon von früheren Architekturausstellungen unterscheidet: „Wir wollen den Ausstellungsraum nicht in herkömmlicher Weise belegen und ausstatten mit Dokumenten unserer architektonischen Arbeit. Solche Ausstellungen langweilen uns, da ihr didaktischer Wert eine trügerische Auskunft unserer Architektur vermitteln würde. Man glaubt, von der Skizze zum fertigen fotografierten Werk etwas nachvollziehen zu können, aber in Wirklichkeit hat man gar nichts begriffen, sondern lediglich Dokumente einer architektonischen Realität zusammenaddiert.“ (Herzog & de Meuron, 2002, 78-79) Die Konsequenz, die Herzog & de Meuron hieraus ziehen, ist die Emanzipation der ausgestellten Architektur von der Architektur als gebauter Realität. An die Stelle einer Illusion folgerichtigen und stringenten Entwerfens, von der ersten Ideenskizze bis zur steinernen Ausformulierung, treten die ansonsten nicht als Kunstwerke betrachteten Hinterlassenschaften jener architektonischen Metamorphose. So kommt zum Vorschein, was üblicherweise hinter den Mauern der prominenten Büros oder Ateliers verborgen bleibt: Zahllose Arbeitsmodelle, morphologische Studien, abstrakte Skizzen und Aufzeichnungen sollen von dem experimentellen Charakter architektonischen Entwerfens als eines ästhetischen Prozesses zeugen. Dies inklusive aller Irrungen und Wirrungen, Fehler und Verwerfungen, von denen jener Schöpfungsprozess geprägt ist. An die Stelle des rational nachvollziehbaren Zusammenspiels von Modell und Zeichnung tritt so die kaleidoskopartige Verschränkung disparater Exponate, die dem Betrachter eine Vielzahl von Deutungsmöglichkeiten anbieten, ohne dass eine einzige hiervon zwingend wäre. Vor allem aber soll hierdurch Einblick in den Kopf des Architekten, in sein bilddurchtränktes Gedächtnis, gewährt werden, auf dessen Grundlage sich in geradezu geheimnisvoller Weise die Materialisierung der Architektur zu vollziehen scheint. |
|
 Abbildung 8: Joseph Michael Gandy, Public and Private Buildings executed by Sir John Soane, 1818 |
Die Interpretation der
Architekturausstellung als eines begehbaren Gedächtnisraums ist ein
Phänomen, das sich beobachten lässt, seitdem sich der Architekt als
künstlerisches Genie begreift. Schon Anfang des 19. Jahrhunderts gestaltete
John Soane sein Haus zum Ebenbild seiner chaotischen Bilderwelt (Abbildung
8). Ägyptische
Sarkophage, Architekturstiche, Urnen, Vasen, Architekturmodelle und Büsten
bedecken noch heute fast vollständig die Wände des kleinen Londoner
Domizils, in dem sich das Genie des romantischen Klassizismus förmlich
eingenistet hat. Der seit der frühen Neuzeit klassische Apparat
architektonischer Vermittlungsmedien, Schrift, Bild und Modell, kommt hier
in seinem ganzen Überfluss zur Anwendung, wenngleich sich nicht übersehen
lässt, dass jene Medien bereits ein Eigenleben entwickelt haben. Denn Soane
konzipiert seine Exponate nicht allein im Hinblick auf ihre didaktische
Funktion. Darüber hinaus werden sie gemeinsam mit Soanes umgestalteten Haus
zum Gegenstand monumentaler Architekturgemälde, in denen die Differenz
zwischen Modell, Bauwerk und Bild aufgehoben scheint, um den künstlerischen
Kosmos Soanes in Form eines imaginären Ausstellungsraums heroisch zu
überhöhen (vgl. hierzu Richardson & Stevens, 1999). Bereits hier scheint also zu gelten, was Ilka und Andreas Ruby unlängst als Amalgam aus Architektur und Bild, als den fließenden Übergang des einen in den Aggregatzustand des jeweils anderen bezeichneten (Ruby & Ruby, 2004, 157). Hiermit war allerdings nicht die historische Entwicklung des Architekturbildes seit dem 18. Jahrhundert gemeint, sondern der gegenwärtige „iconic turn of architecture“, der gleichsam in der Tradition der Renaissance und ihrer Verschleifung von Architektur und Bild unter dem Primat der Perspektive stehe. Donato Bramantes illusionistischer Chor von Santa Maria presso San Satiro in Mailand schien so, ungeachtet der sich wandelnden Darstellungsmittel, als zeitloses Manifest jener komplexen medialen Durchdringung von Bild und Raum gelten zu dürfen. Wie sehr jener Vergleich zwischen der Renaissance und der Gegenwart allerdings hinkt, wird bereits anhand der Tatsache deutlich, dass dem Architekturbild zur Zeit Bramantes noch längst kein autonomer Status zugebilligt wurde, geschweige denn, dass es mit dem Gebauten auf eine Stufe gestellt worden wäre. Es fehlte also jede Voraussetzung für eine tatsächliche Durchdringung des Imaginierten mit dem Gebauten. Im Gegenteil, die Hierarchien des architektonischen Entwurfsprozesses blieben im Unterschied zur heutigen Situation gewahrt. Die wissenschaftliche Grundlegung der Architektur, die systematische und kodifizierte Darstellung des Raumes im Bild, verhinderte gleichsam derartige Entgrenzungen zugunsten nachvollziehbarer Rationalität. |
|
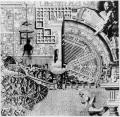 Abbildung 9: Aldo Rossi, La Città Analoga, 1976 |
Plausibler erscheint daher der Hinweis, dass die neue Ikonophilie der
Architektur wesentlich von den Entwicklungen der letzten Jahrzehnte
profitierte, die von dem Versuch geprägt waren, den allseits beklagten
modernistischen Ikonoklasmus zu überwinden. In „La città analoga“ etwa, das
Rossi anlässlich der Biennale von 1976 ausstellte (vgl. hierzu Ruhl,
2006/1), verdichten sich wie in Soanes Museum auf der annähernd
quadratischen Bildfläche in schier unüberschaubarer Fülle
Alltagsgegenstände, Stadtpläne, Landkarten und Kunstwerke zu einem komplexen
Gedächtnisrelief des Architekten, das mit Hilfe des Verstandes kaum
auflösbar erscheint (Abbildung
9). Mit anderen
Worten, im zweidimensionalen Bildraum wird die subjektive Vorstellungswelt
des Architekten, auf der sein imaginatives Potenzial beruht, zur Schau
gestellt. Zugleich wird es aber auch mittels verschiedener Bildstrategien -
Fragmentarisierung, Übereinanderblendung, Verfremdung - verschleiert. Das
Architekturbild macht sich so die Bildstrategien der Kunst zu Eigen und
strebt im Extremfall sogar seiner gebauten Realisierung entgegen. Zumindest
dann, wenn man Robert Venturis Auffassung Ernst nimmt, dass die Architektur
wie die Malerei eine autonome Bildkunst sei, deren ikonografischer Reichtum
gleichsam unbegrenzt ist (vgl. hierzu Ruhl, 2006/2). |
|
 Abbildung 10: Ludwig Mies van der Rohe, Projekt für ein Bürohaus in der Friedrichstraße, Berlin, 1921  Abbildung 11: Entwurf Elbphilharmonie |
Die Frage nach dem
Erkenntnispotential sowie der Zielsetzung ästhetischer Strategien ist indes
nicht allein an den Architekten adressiert. Zugleich offenbaren sich an
dieser Stelle die Defizite von Architekturgeschichte, Architekturkritik und
Architekturtheorie, die es - dies gilt zumindest für das 20. Jahrhundert -
bisher weitestgehend versäumt hat, die Medialität der Architektur, die
Mittel und Formen ihrer Repräsentation, ihre ästhetischen Strategien, als
denkwürdige Beiträge in aller Konsequenz Ernst zu nehmen. Was in den
Bildwissenschaften längst selbstverständlich ist, muss sich hier erst noch
gegen die latente Hierarchie von Bild und Bau, von Werk und Beiwerk,
durchsetzen. Ob hierzu gleich die Institutionalisierung einer „science of
architectural images“ (Ursrpung, 2002, 6) notwendig ist, wie Philipp
Ursprung meint, ist fraglich. Ignorieren lässt sich allerdings nicht, dass
seit der schier explodierenden Bildproduktion Ende des 20. Jahrhunderts die
ästhetischen Strategien gelegentlich an die Stelle der theoretischen
Reflexion treten, ja gar den Eindruck vermitteln, allein durch das Bild
ließe sich die Komplexität des Entwerfens in Bildern und Räumen angemessen
vermitteln. Umso mehr scheint es geboten, die Architektur einer
bildkritischen Analyse zu unterziehen anstatt in sprachloser Ehrfurcht
darauf zu hoffen, dass sich wie einstmals in Berlin nun auch im Hamburger
Elbhafen Überirdisches ereignen möge (Abbildungen 10 und 11). Denn dass
durch derartige Bilder die evozierte Architektur bereits unauslöschlich in
das kollektive Gedächtnis eingeschrieben ist, ja die Verwirklichung des
Projektierten gar nicht mehr nötig scheint, weil es im Medium des Bildes
bereits Teil der Wirklichkeit ist, sollte zu denken geben. Insbesondere
dann, wenn es um die Institutionalisierung der Architekturvermittlung als
eines Studiengangs geht, der über die wirkungsvolle Selbstdarstellung hinaus
auch deren kritische Analyse beinhaltet.
Literatur:
Brausch, M. & Emery, M. (Hrsg.) (1995). Fragen zur Architektur. Fünfzehn Architekten im Gespräch. Basel: Birkhäuser. Gadamer, H.-G. (1986). Hermeneutik I, Wahrheit und Methode, Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik In: H.-G. Gadamer, Gesammelte Werke, Bd. I, 5. Aufl., Tübingen: Mohr. Herzog J. & de Meuron, P. (1990). Leidenschaftlich treulos. Ouvertures, 5. Herzog, J. (1997), Die verborgene Geometrie der Natur In: G. Mack (Hrsg.), Herzog & de Meuron 1992-1996, Das Gesamtwerk Band 1 (S. 207-211). Basel: Birkhäuser. Herzog, J. & de Meuron, P. (2000), Firmitas, Vortrag an der ETH Zürich, Oktober 1996 In: G. Mack (Hrsg.), Herzog & de Meuron 1992-1996. Das Gesamtwerk Band 3 (S. 222-225). Basel: Birkhäuser. Herzog, J. & de Meuron, P. (2002). Alles nur Abfall In: P. Ursprung (Hrsg.) Herzog & de Meuron: Naturgeschichte (S. 78-79). Baden: Lars Müller. Johnson, P. & Wigley, M. (Hrsg.) (1988/1). Deconstructivist Architecture: The Museum of Modern Art, New York. Boston: Little Brown. Johnson, P. & Wigley, M. (Hrsg.) (1988/2). Dekonstruktivistische Architektur. Stuttgart: Hatje. Mack, G. (Hrsg.) (1996). Herzog & de Meuron 1989-1991. Das Gesamtwerk. Bd. 2. Basel: Birkhäuser. Mack, G. (Hrsg.) (1997). Herzog & de Meuron 1978-1988. Das Gesamtwerk. Bd. 1. Basel: Birkhäuser. Mack, G. (Hrsg.) (2000). Herzog & de Meuron 1992-1996. Das Gesamtwerk. Bd. 3. Basel: Birkhäuser. Mack, G. (2006). Versuch und Irrtum. Das Münchner Haus der Kunst präsentiert die Architektur von Herzog & de Meuron. Süddeutsche Zeitung, 12. Mai, 13. von Moos, S. (2004). Nr. 250. Überlegungen zum Schaulager der Emanuel Hoffmann-Stiftung in Basel von Herzog & de Meuron In: S. Claus, M. Gnehm, B. Maurer, B. & L. Stalder, (Hrsg.), Architektur weiterdenken. Werner Oechslin zum 60. Geburtstag (S. 339-358). Zürich: gta-Verlag. Lampugnani, V. M. (1981). Ausstellungen von Architektur. Eine fragmentarische Übersicht für Europa und die USA In: J.P. Kleihues, Internationale Bauausstellung Berlin 1984. Erste Projekte (S. 30-55). Berlin: Quadriga. Leach, N. (2000). The Anaesthetics of Architecture. Cambridge: MIT Press. Lefèbvre, H. (1974). La production de l´espace. Paris: Anthropos. Lefebvre, H. (2000). The production of space. Oxford: Blackwell. Richardson, M. & Stevens, M.-A. (Hrsg.) (1999). John Soane. Architect. Master of Space and Light. London: Royal Academy of Arts. Ruby, I. & A. (2004). Contemporary architecture and the return of the image In: I. Ruby, A. Ruby & P. Ursprung, Images. A Picturebook of Architecture (S. 152-157). München: Prestel. Ruhl, C. (2006/1). Im Kopf des Architekten: Aldo Rossis La città analoga. Zeitschrift für Kunstgeschichte, 1, 67-98. Ruhl, C. (2006/2). Der romantische Ikonograph. Robert Venturi und die Komplexität des Bildes. archplus, 176, 4-6. Ursprung, P. (Hrsg.) (2002). Herzog & de Meuron: Naturgeschichte (Ausstellungskatalog). Baden: Lars Müller.
Vogt, A.M. (2002). Etienne-Louis Boullée besucht die Tate
Modern In: P. Ursprung, (Hrsg.) Herzog & de Meuron: Naturgeschichte (S.
177-183). Baden: Lars Müller. |
|
|
|
|
[1] Zu Venturis Auffassung schreibt Lefèbvre: „Is it really possible to use mural surfaces to depict social contradictions while proclaiming something more than graffiti?” (Lefebvre, 2000, 145) [2] „In diesem Sinne nehme ich an, dass Boullée von einem Glücksgefühl heimgesucht wurde, als er aus der Distanz seiner Jenseitigkeit beobachten konnte, auf welche Art in der frühen Phase der Stromgewinnung ein Turbinenhaus dimensioniert werden musste. [...] Hier war, in den Augen Boullées, endlich der Fall eingetreten, wo die erhabene Dimension ganz einfach als Erfüllungsfunktion der Bauaufgabe notwendig wurde. [...] Boullée hat den Eindruck, dass die Basler Architekten eine Reihe von Einzelschritten [...] locker addieren, um zu einem erneuerten, erfrischten Ganzen zu kommen, das dem Altbau von Scott den Respekt nie ganz entzieht.“ (Vogt, 2002, 179)
[3]
„Zwischen all die archivarischen und naturkundlichen Abfallprodukte
haben die Kuratoren mit viel List auch einige wirkliche Kunstwerke
geschmuggelt [...]. Soll auch dies nur Abfall sein oder will sich
der ausgebreitete Abfall der Archivgegenstände durch diese
Kunstwerke nobilitieren und im Glanz der uns allen wohl vertrauten,
häufig zu Brands gewordenen Ästhetik sonnen?“ (Herzog & de Meuron,
2002, 78-79) |
| feedback | ||